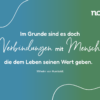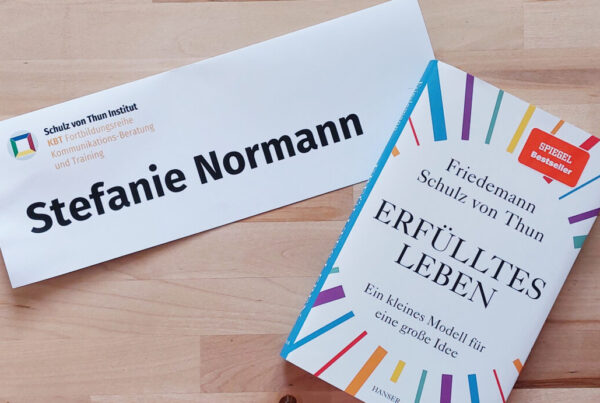Kommunikation ist der Schlüssel zu erfolgreichen Beziehungen, effizienter Zusammenarbeit in Teams und klaren Botschaften. Doch welche Mechanismen steuern den Austausch von Informationen? Und wie lassen sich Missverständnisse vermeiden? In einer Serie stelle ich die aus meiner Sicht wichtigsten Kommunikationsmodelle für berufliche (und auch private) Kommunikation vor. Dies ist Teil 1.
1. Das Sender-Empfänger-Modell (Shannon & Weaver, 1949)
Dieses Modell ist der Startpunkt aller Kommunikationsmodelle. Das Sender-Empfänger-Modell stammt aus der Informationstheorie und beschreibt Kommunikation als technischen Prozess: Ein Sender kodiert eine Nachricht, übermittelt sie durch einen Kanal – beispielsweise Sprache, Schrift, digitale Medien – und der Empfänger dekodiert sie. Entscheidend ist, dass beide Seiten denselben Code verwenden – etwa eine gemeinsame Sprache oder Fachterminologie. Störquellen („Noise“) wie Hintergrundgeräusche, unklare Formulierungen oder technische Probleme können die Nachricht verfälschen oder unterbrechen.
Das Modell geht von einer linearen Übertragung aus und berücksichtigt zunächst keine Rückkopplung oder emotionalen Aspekte. Es eignet sich besonders, um grundlegende Kommunikationsprozesse zu verstehen, etwa bei der Erstellung von Anleitungen, E-Mails oder Präsentationen. Um zwischenmenschliche Dynamiken wie Beziehungen oder nonverbale Signale geht es hier eher nicht.
Literatur: Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949): The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press.
2. Das Johari-Fenster (Luft & Ingham, 1955)
Das Johari-Fenster ist ein Modell der Selbstwahrnehmung und zwischenmenschlichen Kommunikation. Die Vornamen der Autoren, Joseph Luft und Harry Ingham, sorgen zusammengesetzt für den Namen des Johari-Fensters. Das Modell unterteilt die Persönlichkeit in vier Bereiche:
- die öffentliche Person (bekannt für sich selbst und andere)
- den blinden Fleck (anderen bekannt, einem selbst nicht)
- die private Person (einem selbst bekannt, anderen nicht) und
- das Unbewusste (weder sich selbst noch anderen bekannt).
Durch Selbstoffenbarung (aktives Teilen von Informationen) und Feedback (Rückmeldungen von anderen) kann die öffentliche Person vergrößert werden. Kommunikation und Vertrauen in Teams werden verbessert, indem blinde Flecken verkleinert und private Bereiche gezielt geöffnet werden. Das Modell betont, dass Transparenz und Offenheit die Zusammenarbeit stärken. Daher wird das Johari-Fenster wird im Coaching und in der Teamentwicklung genutzt, um Vertrauen aufzubauen und Kommunikation zu vertiefen.
Literatur: Luft, J., Ingham, H. (1955): The Johari Window: A Graphic Model of Interpersonal Awareness. Proceedings of the Western Training Laboratory in Group Development. Los Angeles, UCLA.
3. Die 5 Axiome der Kommunikation (Watzlawick, 1969)
Paul Watzlawick formulierte fünf grundlegende Axiome, die jede zwischenmenschliche Kommunikation prägen. Dabei definiert er Kommunikation so: „Es muss ferner daran erinnert werden, dass das „Material“ jeglicher Kommunikation keineswegs nur Worte sind, sondern auch alle paralinguistischen Phänomene (wie z.B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der Sprache, Pausen, Lachen und Seufzen), Körperhaltung, Ausdrucksbewegung (Körpersprache) usw. innerhalb eines bestimmten Kontextes umfasst – kurz, Verhalten jeder Art.“ (Watzlawick 1969, S. 58)
Die Axiome sind:
- Man kann nicht nicht kommunizieren – selbst Schweigen oder Nichtstun sendet eine Botschaft.
- Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt – der Beziehungsaspekt bestimmt, wie die Inhaltsebene verstanden wird.
- Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung zugleich – sie beeinflusst das Verhalten der Gesprächspartner und wird von ihm beeinflusst.
- Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler (sprachlicher) und analoger (nonverbaler) Modalitäten – beide Ebenen ergänzen sich, können aber auch widersprüchlich sein.
- Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär – entweder auf Augenhöhe (symmetrisch) oder in einer Über-/Unterordnung (komplementär).
Diese Axiome erklären, warum Kommunikation so komplex ist und warum Missverständnisse entstehen. Sie zeigen, dass jeder Austausch mehrdeutig ist und Kontext, Tonfall sowie Körpersprache eine zentrale Rolle spielen. Mit Hilfe der Axiome kann man Kommunikationsmuster in Teams analysieren und bewusster gestalten.
Literatur: Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (1969): Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien. Bern (Hogrefe).
Teil 2 der Serie zu Kommunikationsmodellen wird in loser Folge erscheinen.
Foto: Dmitriy Novikov / Unsplash